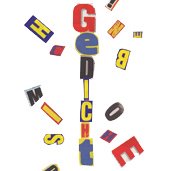Die konkrete Poesie ist eine besondere Herangehensweise an die Sprache: Sie verwendet die visuellenund akustischen Dimensionen der Sprache als literarisches Mittel. So dient die Sprache vordergründig nicht mehr der Beschreibung sondern wird selbst zum Zweck des Gedichts. In der visuellen Poesie werden Wörter, Buchstaben oder Satzzeichen aus dem Zusammenhang der
Sprache heraus gelöst und treten dem Betrachter für sich selbst stehend, konkret! gegenüber.

Das Sprichwort "vor die Hunde gehen" als Konkrete Poesie. (c) A. B. Braun, 2007
Neben der visuellen Poesie gehört auch die Lautpoesie zur konkreten Poesie. Die entscheidende poetische Tätigkeit ist jeweils die Gestaltung, die neuartige Zusammensetzung der einzelnen Sprachelemente – dennoch bleibt es die Sprache, die solche poetischen Konstruktionen mit Leben füllt.
Aus der griechischen Spätantike stammt die Technik des Figurengedichts, bei dem der Text soentworfen wird, dass durch die Anordnung der Buchstaben und gegebenenfalls durch zusätzlich eingeschriebene Verse ein Gegenstand bildlich repräsentiert wird, der zum Inhalt des Textes in einer Beziehung steht.
Zur Zeit des Barock wird das Figurengedicht in Deutschland besonders in den Schäferdichtungen wiederbelebt; auch in anderen Gattungen werden neue Verbindungen von Bild, Wort und Schrift erprobt.
Die Poetik der Aufklärung propagiert die poetische Form nicht als Herrin, sondern als Dienerin des Gedankens.
Die Dichter des Futurismus, Dadaismus und Surrealismus setzen diese Entwicklung fort – der bekannteste Vertreter ist Guillaume Apollinaire mit seinen „Calligrammes“. Ihre Absicht ist es, die unbewusste oder ausgeblendete Materialität und Schriftlichkeit der Dichtung wieder ins Bewusstsein zu heben.
Der Begriff „Konkrete Poesie“ entstand schließlich in Anlehnung an die bildende Kunst, bei der die entsprechende Bezeichnung „Konkrete Kunst“ lautete. In der Dichtung wurde „konkrete Poesie“ von Eugen Gomringer (geb. 1925) aufgegriffen und popularisiert (1953). Auch die brasilianische Künstlergruppe „Noigandres“ forderte bereits 1956, mit der Eröffnung ihrer Ausstellung „Arte Concreta“ (Konkrete Kunst), das Wort nicht mehr als bloßen Träger von Bedeutung wahrzunehmen, sondern in seiner Gesamtheit zu sehen. Das Wort sollte als Artefakt poetisch werden. Angeregt von Eugen Gomringer und den Dichtern der Noigandres-Gruppe aus Brasilien entstand in den 1950er Jahren innerhalb der Konkreten Poesie ein besonderes Interesse an Visueller Poesie, was auch eine wissenschaftliche Auseinandersetzung mit sich brachte. Neben den Künstlergruppen Wiens und Frankfurts werden die Ansätze der Visuellen Poesie z.B. auch in der japanischen Tradition aufgegriffen: „Shikakushi“ (Text für das Auge) oder "Shishi" (Sehtext).
Viele Vertreter der konkreten Poesie gehören dem Umkreis der Wiener Gruppe und der Stuttgarter Schule um Max Bense an. Weitere klangvolle Namen wären u.a.: Guillaume Apollinaire, Chris Bezzel, Reinhard Döhl, Helmut Heißenbüttel, Ernst Jandl, Kurt A. Mautz, Franz Mon, Diter Roth, Gerhard Rühm, Siegfried J. Schmidt, Kurt Schwitters, Oswald Wiener.